Bei fachgerechter Planung und Pflege steigert ein Solarpark auf einer Ackerfläche die Biodiversität – das ist die Quintessenz einer Studie, die der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) bei den Experten Rolf und Tim Peschel in Auftrag gegeben hat. Die Studie basiert auf insgesamt mehr als 100 Einzeluntersuchungen und insgesamt 40 Untersuchungsberichten. Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich bei der Studie um die weltweit umfangreichste Analyse der Artenvielfalt in Solarparks auf Landwirtschaftsflächen.
Für das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) stellt die Studie einen dankenswerten Diskussionsbeitrag der Branche zum Schließen der noch immer bestehenden Wissenslücken dar. Nichtsdestotrotz über das KNE Kritik an der Arbeit.
KNE sieht methodische Mängel
Die Validität der Studie hätte gewonnen, wenn bestimmte Standards des wissenschaftlichen Arbeitens mehr Beachtung erhalten hätten, schreibt der KNE in einer Stellungnahme. „So verzichten die Autoren beispielsweise auf die nachvollziehbare Darstellung der Untersuchungsmethoden sowie auf eine Begründung der Auswahl von Untersuchungsflächen und untersuchten Organismengruppen“, heißt es dort.
Auch eine Beschreibung der Vornutzung auf den Solarparkflächen sei nicht erfolgt. Vielmehr werde pauschal angenommen, dass Ackerstandorte mit Düngemitteln und Pestiziden belastet und daher artenarm seien. Hilfreich für die Interpretation der Ergebnisse wären in den Augen des KNE auch systematisch aufbereitete Informationen zur Einbindung der Untersuchungsflächen in die Landschaft gewesen, um die Besiedelung mit zugewanderten Arten besser nachvollziehen und daraus Maßnahmen für zukünftige Projekte ableiten zu können. „Das reine Aufsummieren der bundesweit gefundenen Arten lässt keine Rückschlüsse darüber zu, welche Bereiche in den Solarparks welchen Arten Lebensraum bieten“, schreibt das KNE.
Kaum Angaben zu den Designs der Solarparks
Dem KNE zufolge ist das Anlagendesign – also etwa den Überstellungsgrad, die Modultischhöhe, den Reihenabstand, die Umzäunung – und das Pflegekonzept für ausschlaggebende Stellgrößen der Habitatqualität von Solarparks. Zu diesen mache die Gutachten aber keine genauen Angaben. Es werde erwähnt, dass Solarparks für die Untersuchung ausgewählt seien, „die die Kriterien einer an Biodiversität ausgerichteten Bauweise und Pflege berücksichtigt haben“, zitiert das KNE aus der Studie. Welche Kriterien dies sind, bleibe unklar. Informationen seien in den 25 Anlagensteckbriefen enthalten, würden aber in der Auswertung im Haupttext nicht ausreichend in einen Zusammenhang mit den gefundenen Arten gebracht. „Die Studie enthält zu Bauweise und Pflege leider keine konkreten Empfehlungen an die Planungspraxis“, so das KNE weiter.
Das KNE weist zudem darauf hin, die Gutachter bei der Feldlerche widersprüchliche Aussagen darüber treffen, wie diese in Solarparks gefördert werden könnten. So heiße es im Bericht zur Anlage Bundorf: „Falls ein hohes Niveau der Siedlungsdichte der Feldlerche langfristig aufrechterhalten werden soll, dann muss der hohe Rohbodenanteil erhalten werden, z. B. durch Maßnahmen wie herbstliches Eggen und Grubbern (ca. alle 3 Jahre je nach Bedarf).“ Im Bericht aus dem Solarpark Bad Liebenwerda kommen die Gutachter dagegen zu dem Schluss: „Mit der weiteren Etablierung von dichteren Vegetationsflächen in den aktuell noch un- oder nur schütter bewachsenen Flächen, wird sich die Habitatqualität für die Feldlerche weiter verbessern.“
Studie als Ausgangspunkt für weitere Auswertungen
Das KNE begrüßt, dass die Erhebungen die bisherigen Annahmen aus Forschung und Verwaltungspraxis zum naturverträglichen Ausbau von Solarparks untermauern. In den ausgewählten Solarparks auf Ackerflächen sei gezeigt worden, dass es zur Artenvielfalt beiträgt, wenn die Grundsätze der Vermeidung und der naturverträglichen Gestaltung berücksichtigt werden.
Die Schlussfolgerung der Autoren, dass Kompensationsmaßnahmen in Solarparks generell verzichtbar seien, verkenne aber, dass sich die Empfindlichkeiten von Standorten und die Bauweisen von Solarparks stark unterschieden. Die Anwendung der Eingriffsregelung leistet hier aus Sicht des KNE einen wesentlichen Beitrag, da so die Vermeidung von negativen Wirkungen in der kommunalen Planung frühzeitig in den Fokus gerückt wird. Über dieses Instrument würden die Mindestanforderungen festgeschrieben, mit denen die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auch außerhalb besonderer Schutzgebiete gesichert und erhalten werden könne.
Um diese Mindestanforderungen fachlich abzusichern, könne die Studie einen wichtigen Beitrag leisten. Hierzu sollten die Ergebnisse in den weiteren fachlichen Austausch eingebracht werden, so das KNE.
Das 2016 gegründete Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) wird von der Umweltstiftung Michael Otto getragen und vom Bundesumweltministerium finanziert. Zweck der gemeinnützigen GmbH ist die Unterstützung einer naturverträglichen Energiewende vor Ort.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.





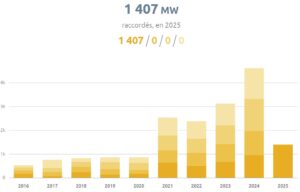
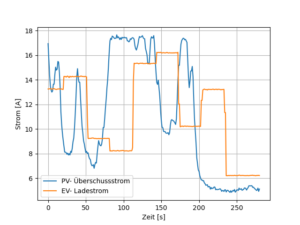

Mit dem Absenden dieses Formulars stimmen Sie zu, dass das pv magazine Ihre Daten für die Veröffentlichung Ihres Kommentars verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Spam-Filterung an Dritte weitergegeben oder wenn dies für die technische Wartung der Website notwendig ist. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, dies ist aufgrund anwendbarer Datenschutzbestimmungen gerechtfertigt oder ist die pv magazine gesetzlich dazu verpflichtet.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht, wenn das pv magazine Ihre Anfrage bearbeitet oder der Zweck der Datenspeicherung erfüllt ist.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.