Die deutsche Bundesregierung hat als Ergänzung zu ihrer Kraftwerksstrategie ein Konzept für einen Kapazitätsmechanismus angekündigt. Sie plant dessen Einführung spätestens bis 2028. Die genaue Ausgestaltung wird derzeit noch diskutiert. Deshalb haben sich die Analysten von Aurora Energy Research nach eigener Aussage für ihre Simulationen unter anderem an den Regularien orientiert, die sich in anderen Ländern bereits bewährt haben.
„Unter den getroffenen Annahmen zeigt sich, dass ein zentral geführter Kapazitätsmechanismus in Deutschland bis 2035 einen Zubau von mindestens zwölf Gigawatt an wasserstofffähigen Gaskraftwerken ermöglichen würde, die schrittweise auf Wasserstoff umrüsten“, erklärt Sarah Schoch, Autorin der Studie „Design Options and Impacts of a German Capacity Market“. „Auch der Zubau anderer Technologien wie Batterien wird durch einen Kapazitätsmechanismus angereizt, wie wir bei Auktionen in anderen Ländern sehen. Zusammen mit den 10,5 Gigawatt an neuen Gas- und Wasserstoff-Kraftwerken, die durch die Kraftwerksstrategie geschaffen werden sollen, würde so die durch den Kohleausstieg verursachte Kapazitätslücke bis 2035 geschlossen.“
Kosten und Wirksamkeit des Kapazitätsmechanismus
Die Analysten schätzen die Kosten des Kapazitätsmechanismus auf einen durchschnittlichen Mehrpreis von 0,4 Cent pro Kilowattstunde, wenn diese gleichmäßig auf alle Stromverbraucher umgelegt werden. Dies liegt deutlich unter der inzwischen abgeschafften EEG-Umlage, die zuletzt 3,72 Cent pro Kilowattstunde betrug.
Kosten und Wirksamkeit eines Kapazitätsmechanismus – sowie die Auswirkungen auf verschiedene Technologieoptionen – sind nach Ansicht der Studienautoren von Aurora Energy Research stark von der konkreten Ausgestaltung abhängig. „Die meisten Märkte haben ein bis vier Jahre Vorlaufzeit bei den Auktionen und Verträge für Neubauten haben größtenteils eine Laufzeit von 15 Jahren“, sagt Lars Jerrentrup, Energiemarktexperte bei Aurora Energy Research. Der Gesetzgeber müsse seiner Ansicht nach eine an die Besonderheiten des deutschen Strommarkts angepasste Lösung finden. So würde die Bewertung von Speichertechnologien und die Einbindung von Nachfrageflexibilität unterschiedlich gehandhabt. Das habe dann einen entscheidenden Einfluss darauf, wie technologieoffen der Kapazitätsmechanismus tatsächlich wirkt. Zudem variiere die Höhe eines möglichen Maximalpreises in den Auktionen in bestehenden europäischen Systemen erheblich. Er reicht von 77.000 bis 164.000 Euro pro Megawatt. „Dieser Preis müsste den deutschen Anforderungen angepasst werden, unter Berücksichtigung der geplanten Dekarbonisierungsvorgaben für neue Gaskraftwerke“, so Jerrentrup. Um das Ziel maximaler Versorgungssicherheit bei möglichst niedrigen volkswirtschaftlichen Kosten zu erreichen, sei es zudem wichtig, dass sich die Bundesregierung eng mit Deutschlands Nachbarländern abstimmt und den Kapazitätsmechanismus kontinuierlich an veränderte Rahmenbedingungen anpasse.
Kapazitätsmechanismen tragen zur Versorgungssicherheit bei
Kapazitätsmechanismen ermöglichen die Finanzierung regelbarer Kraftwerke und leisten einen Beitrag zum Schließen der Kapazitätslücke, die durch den Kohleausstieg verursacht worden ist, so die Einschätzung von Aurora Energy Research. Zudem würden sie zur Versorgungssicherheit während der Energiewende beitragen. „Je höher der Marktanteil der erneuerbaren Energien mit ihren niedrigen Grenzkosten wird, desto weniger rentabel ist unter den bisherigen Marktbedingungen der Bau und Betrieb der nötigen regelbaren Kraftwerke“, erklärt Lars Jerrentrup weiter. Diese Kraftwerke liefen einfach zu selten und erzielten in der Regel keine ausreichend hohen Strompreise, um allein auf Basis des Stromverkaufs profitabel zu sein. Ein Kapazitätsmechanismus biete seiner Ansicht nach eine Lösung, indem Betreiber zusätzlich für das Bereitstellen regelbarer Leistung vergütet werden.
Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.



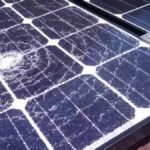
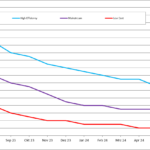



… bin gespannt, was dabei herauskommt. Die Strategie für den Kapazitätsmarkt ist aus meiner Sicht entscheidend für den Erfolg der Energiewende, dass freier Markt und echte EE- und Speicherdynamik mit einem flex. Verbrauchsmarkt ohne teure Grundlast Barrieren stattfinden kann.
Das darf dann auch etwas kosten, nur sollten aus meiner Sicht diese Kosten nicht ausschließlich dieser einen Generation in der Investitionsphase und womöglich auf den Strompreis aufgestülpt werden. Das ist im Sinne der marktwirtschaftlich erforderlichen Dynamik widersinnig… insofern teile ich das Vorhaben von Habeck eines Amortisationskontos wie bei Wasserstoff, das die Kosten auf die Jahrzehnte streckt und sie nicht gerade jetzt im so wichtigen Aufbau zum Hemmnis werden. Die Gesellschaft muss „jetzt“ von niedrigen Preisen in den EE-Phasen profitieren, damit jetzt die Akzeptanz hochfährt und damit jetzt Hersteller wie Verbraucher in EE und Speicher gewinnbringend und maximal umfänglich investieren können und wollen. Profitieren werden noch viele Generationen für diesen teuren Kraftakt des Aufbaus der Infrastruktur, es rechnet sich für alle.
Ich glaube nicht an Wasserstoff als wesentlich in der Energiewende in Deutschland. Wir kriegen ihn hier nicht so billig, dass er wettbewerbsfähig wäre.
Warum betreibt man die dann noch nötigen Gas-Kraftwerke nicht besser mit Biogas!?
Ich denke, das passiert auf kurz oder lang. Noch ist die bestehende Förderung attraktiver, als alles teuer und mit Aufwand umstellen zu wollen. Wasserstoff für Strom kommt aus meiner Sicht frühestens 2035 schrittweise zum Einsatz. Bis dahin wird hoffentlich auch Biogas ganz überwiegend flexibel eingesetzt. Wenn die Energiewende gut läuft, sind es so am Ende vielleicht nur noch 3-5% oder 50-100TWh, die mit H2 für „echte“ Dunkelflauten abzudecken sein werden. Das ist aus meiner Sicht zu stemmen…
@ Detlef K.
Es wird zwar oft behauptet, das Biogas als Strom Lückenfüller gut geeignet wäre .
Bei genauerer Betrachtung ist es leider nicht so .
Im Schnitt beträgt die Vergütung für Biogasstrom ca. 20 Cent je KWh . Viel zu viel Geld .
Für das überbauen , das heißt größere Gasspeicher und mehr Biogasmotoren ist weitere extra Förderung notwendig .
Das Geld kann man lieber in die E- Auto Förderung stecken , denn die stehen 23 Stunden am Tag nur rum und ergeben ein viel günstigeres Speicher Potetial .
Die Gasspeicher können auf den Betrieben jedoch nicht unbegrenzt groß gebaut werden .
Tagesschwankungen an der Strombörse können bedient werden ,jedoch bei mehrtägigen Dunkelflauten bringen diese Anlagen auch nichts .
Allenfalls Biogasanlagen , die ihr Gas zu Biomethan aufbereiten sind hier von Vorteil , da sie das Gas in das Erdgasnetz einspeisen .
Von den 8500 Biogasanlagen in Deutschland , können das zur Zeit aber lediglich ca. 250 Anlagen .
Batterien sind für Kurzfristige Überbrückungen viel besser , da deren Kosten erheblich gesunken sind, ( ganz im Gegensatz zu Biogas ) .
Außerdem können Batterien überschüssigen erneuerbaren Strom aufnehmen .
Das kann Biogas leider auch nicht bieten .
Für viele Bauern war die 20 Jährige Biogaszeit zwar stressig , aber meistens lukrativ.
Es gab während der Zeit aber nur geringe Effizienzsteigerungen . Schade .
Der Bedarf an Landwirtschaftlichen Flächen für den Substratanbau ist einfach viel zu groß .
Bleiben nur noch Reststoffe wie Gülle oder ähnlich . Riesige ungenuztzte Reststoffmengen sind leider nicht mehr verfügbar .
Biogas , zumindest aus Anbaubiomasse , ist ein totes Pferd .